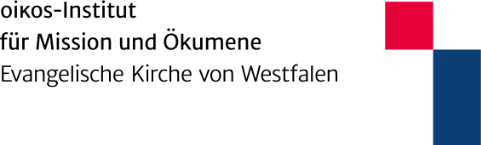Rassismus ist eine koloniale Idee
Erstes Fachforum Internationale Ökumene der VEM mit oikos-Beteiligung
Die Tagung hatte sich zum Ziel gesetzt, koloniale Kontinuitäten im eigenen Arbeitskontext aufzuspüren und Strategien zur Überwindung zu entwerfen. Im ersten Vortrag stellte Serge Palasie, Fachpromotor für Flucht, Migration und Entwicklung des Eine Welt Netzes NRW, zu Beginn klar, dass Rassismus eine koloniale Idee sei, die die willkürliche Kategorisierung von Menschen allein aufgrund ihrer äußeren Merkmale umfasst. Diese und weitere koloniale Kontinuitäten setzten sich bis in die heutige Gesellschaft fort und in den Köpfen vieler Menschen fest.
Als Beispiele nannte er unfaire Handelsbeziehungen, Kunsthandel und -raub sowie die Unterscheidung in „Hoch- bzw. Primitivkultur“, Klimaungerechtigkeit, Ungleichheit in der Wissensproduktion und Meinungsbildung, politische Repräsentanz, Erinnerungspolitik, aber auch die sogenannte „Entwicklungspolitik“ und den wiedererstarkenden Rassismus. Angesprochen auf derartige koloniale Kontinuitäten reagierten viele Menschen heutzutage mit Verdrängung oder Beschönigung. Dabei erlaubten es die demografische Entwicklung in Deutschland und die Verlagerung globaler Kräftekonstellationen im Grunde genommen nicht, dieses Problem zu ignorieren oder nur halbherzig anzugehen. Um Deutschland in einer sich im Wandel befindlichen Welt zukunftssicher zu gestalten, forderte er dringend eine neue Erinnerungskultur.
Bereits in der Vorstellungsrunde traten unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Mission und Kolonialismus zu Tage: „Mission hat uns in unserer Kultur befreit. Aber in der deutschen Gesellschaft gibt es eine Tendenz zur Kirchenfeindlichkeit. Und das Postulat: ‚Was die Kirche in der Vergangenheit gemacht hat, war alles falsch‘“, so formulierte ein Süd-Nord-Mitarbeiter seine Erfahrungen mit dem Thema in Deutschland.
Mit Blick auf die Rolle der Kirche in Zeiten des Kolonialismus erklärte Serge Palasie, dass missionarische Tätigkeit auch immer Teil der Kolonialisierung gewesen sei. Missionare und Missionarinnen hätten sich oftmals ambivalent verhalten. Als Beispiel nannte er den spanischen Theologen Bartolomé de las Casas und späteren Bischof von Chiapas. Dem Eroberer und Kolonisten wurde vorgeworfen, den Handel mit afrikanischen Sklavinnen und Sklaven eingeführt oder zumindest angeregt zu haben. Lange Zeit hielt er ihren Einsatz für rechtmäßig, zu einem Sinneswandel kam es erst später.
Der digital hinzugeschaltete zweite Gastredner, Dr. Fidon Mwombeki, vormaliger VEM-Generalsekretär und heutiger Generalsekretär der All Africa Conference of Churches (AACC), wollte die Rolle der Missionare und die der Kolonialisten hingegen klar voneinander unterschieden haben. Nach seiner Auffassung folgten die Missionare ihrem göttlichen Ruf und brachten das Evangelium in die Welt, während es die Kolonialisten waren, die Land und Rohstoffe raubten, Gemeinschaften entzweiten und willkürlich Grenzen zogen und die im Freiheitskampf letztlich aus dem Land gejagt wurden. Die Errungenschaften missionarischer Tätigkeiten wie Bildung und fortschrittliche medizinische Versorgung würden indes in Afrika immer noch sehr wertgeschätzt.
Koloniales Erbe in der kirchlichen Partnerschaftsarbeit
Dennoch erkannte der tansanische Theologe sicht- und unsichtbare koloniale Spuren, die die Partnerschaftsarbeit zwischen afrikanischen und deutschen Kirchen bis heute prägen. Diese fasste er in vier Punkten zusammen:
1. Über- und Unterlegenheitshaltung. Aufgrund der kolonialhistorischen Geisteshaltung würden die Partnerschaften unter der Überlegenheitshaltung der Europäer*innen und der Unterlegenheitshaltung der Afrikaner*innen leiden. Begründet werde diese Einstellung mit der Vorstellung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Überlegenheit der Europäer*innen. Die afrikanische Seite würde hingegen mit Armut, Elend und Korruption in Verbindung gebracht. Afrikanische Erfolgsgeschichten gäbe es kaum. Beide Seiten könnten diese Geisteshaltung nur schwerlich abschütteln.
2. Geber*innen-Nehmer*innen-Gefälle. Auch hier gebe es immer noch die alte Rollenverteilung. Während die afrikanischen Partner*innen auf der Empfänger*innenseite stehen, gehören die Europäer*innen zu den Geber*innen. Mwombeki betonte, dass es in jedem Setting normal sei, dass der Gebende den Nehmenden bedauere. Dies habe nichts mit Kolonialismus zu tun, sondern mit wirtschaftlicher Überlegenheit, die es überall gebe. Andererseits, so der Theologe, sei es fraglich, ob Europäer*innen überhaupt Geld aus Afrika oder Asien annehmen würden. Europäische Partner*innen fühlten sich mit diesem Geld nicht immer wohl.
3. Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung. Afrikaner*innen betrachten Deutsche vornehmlich in der Lehrer*innenposition und damit als quasi allwissende Person. Der afrikanischen Seite werde hingegen wenig Expertentum zugeschrieben. So werden ordinierte afrikanische Pfarrer*innen in Deutschland oftmals als Assistent*innen behandelt. Das Führen einer eigenen Gemeinde traue man ihnen nicht zu.
4. Organisationelle und institutionelle Strukturen. Vielfach werden Kindergärten, Bibelschulen und Krankenhäuser nach deutschem Vorbild verwaltet und strukturiert. Kirchliche Pensionsfonds beispielsweise wurden ausschließlich von Missionar*innen eingerichtet.
Der Generalsekretär der AACC schlug vier Wege zur Überwindung kolonialer Ungleichheiten vor: 1. Bewusstmachen eigener historisch bedingter Geisteshaltungen. 2. Bewusstmachen, dass tiefgreifende Änderungen nur über Generationen stattfinden können. 3. Willen zur Veränderung negativer Geisteshaltungen, die Spaltungen unserer Gesellschaften begünstigen. 4. Vermeiden von Übersensibilisierungen und Selbstbeschimpfungen, die Partnerschaften unter ein Regime der Ängstlichkeit und Übervorsicht stellen.
In seinem abschließenden Ausblick wies Mwombeki darauf hin, dass derzeit eine weltweite Machtverschiebung zu beobachten sei und dass es nicht mehr die USA und Europa seien, die allein die Standards setzten. Außerdem werde sich aller Voraussicht nach auch das Tempo des wirtschaftlichen Aufschwungs zugunsten beispielsweise der BRIC-Staaten ändern, ganz zu schweigen von der pessimistischen Mitgliederentwicklung in den deutschen Kirchen. Beides werde einen Rückgang von Einfluss und Geld auf deutscher Seite mit sich bringen, der sich auch auf die kirchliche Partnerschaftsarbeit auswirken wird.
Koloniales Erbe in der Zivilgesellschaft
Als letzte Referentin sprach Gilberte Raymonde Driesen. Die Lehrerin, Diversitätstrainerin und Projektleiterin beim deutsch-senegalesischen Verein Axatin e.V. gab einen umfassenden Überblick über den Kolonialismus, seine historischen Wurzeln und seinen Zusammenhang mit dem Kapitalismus. Sie zeigte auf, welche Folgen das koloniale Handeln der Großmächte in den letzten Jahrhunderten für die Gesellschaften auf dem afrikanischen Kontinent hatten und wie groß der Einfluss damals getroffener Entscheidungen auch noch heute für die Menschen vor Ort ist; so führen beispielsweise die von den Kolonialherren im 19. Jahrhundert künstlich bestimmten Landesgrenzen nach wie vor zu Konflikten.
Gilberte Raymonde Driesen schlug dann den Bogen vom Kolonialismus zum Rassismus. Eindrücklich beschrieb sie, dass beides, Kolonialismus und Rassismus, auf allen Ebenen wirkt, sei es auf zwischenmenschlicher, institutioneller oder gesellschaftlich-kultureller Ebene. Es sei unumgänglich, sich mit der eigenen Historie auseinanderzusetzen und den eigenen Standort innerhalb der Gesellschaft zu reflektieren. In dem Zusammenhang betonte sie, wie wichtig ein gesamtgesellschaftliches Umdenken sei, um den Widerstand gegen des Trennende zu stärken bzw. die Dekolonisierung des Geistes voranzutreiben. Dies könne ihres Erachtens nur durch gemeinsame politische Bildung, die Bereitschaft, zuzuhören und das Einüben achtsamen Umgangs miteinander geschehen.
Nach den drei Vorträgen waren die Teilnehmenden des Fachforums am nächsten Tag gefordert, selbst aktiv zu werden. In Kleingruppen reflektierten sie zunächst über das tags zuvor Gehörte, identifizierten sie koloniale Kontinuitäten im eigenen Arbeitsbereich sowie in der eigenen Partnerschaftsarbeit und tauschten sich über mögliche Methoden zur Überwindung eben dieser aus. Im Plenum wurde einhellig festgestellt, dass man, bezogen auf den gesamten Themenkomplex, in den vergangenen Jahren schon einiges erreicht habe, es aber noch sehr viel zu tun gäbe.
Text und Fotos: Martina Pauly, VEM
Rassismus ist eine koloniale Idee
![IMG_6434[1]](https://www.oikos-institut.de/wp-content/uploads/2024/02/IMG_64341-scaled-e1708335295912.jpeg)
Erstes Fachforum Internationale Ökumene der VEM mit oikos-Beteiligung
Die Tagung hatte sich zum Ziel gesetzt, koloniale Kontinuitäten im eigenen Arbeitskontext aufzuspüren und Strategien zur Überwindung zu entwerfen. Im ersten Vortrag stellte Serge Palasie, Fachpromotor für Flucht, Migration und Entwicklung des Eine Welt Netzes NRW, zu Beginn klar, dass Rassismus eine koloniale Idee sei, die die willkürliche Kategorisierung von Menschen allein aufgrund ihrer äußeren Merkmale umfasst. Diese und weitere koloniale Kontinuitäten setzten sich bis in die heutige Gesellschaft fort und in den Köpfen vieler Menschen fest.
Als Beispiele nannte er unfaire Handelsbeziehungen, Kunsthandel und -raub sowie die Unterscheidung in „Hoch- bzw. Primitivkultur“, Klimaungerechtigkeit, Ungleichheit in der Wissensproduktion und Meinungsbildung, politische Repräsentanz, Erinnerungspolitik, aber auch die sogenannte „Entwicklungspolitik“ und den wiedererstarkenden Rassismus. Angesprochen auf derartige koloniale Kontinuitäten reagierten viele Menschen heutzutage mit Verdrängung oder Beschönigung. Dabei erlaubten es die demografische Entwicklung in Deutschland und die Verlagerung globaler Kräftekonstellationen im Grunde genommen nicht, dieses Problem zu ignorieren oder nur halbherzig anzugehen. Um Deutschland in einer sich im Wandel befindlichen Welt zukunftssicher zu gestalten, forderte er dringend eine neue Erinnerungskultur.
Bereits in der Vorstellungsrunde traten unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Mission und Kolonialismus zu Tage: „Mission hat uns in unserer Kultur befreit. Aber in der deutschen Gesellschaft gibt es eine Tendenz zur Kirchenfeindlichkeit. Und das Postulat: ‚Was die Kirche in der Vergangenheit gemacht hat, war alles falsch‘“, so formulierte ein Süd-Nord-Mitarbeiter seine Erfahrungen mit dem Thema in Deutschland.
Mit Blick auf die Rolle der Kirche in Zeiten des Kolonialismus erklärte Serge Palasie, dass missionarische Tätigkeit auch immer Teil der Kolonialisierung gewesen sei. Missionare und Missionarinnen hätten sich oftmals ambivalent verhalten. Als Beispiel nannte er den spanischen Theologen Bartolomé de las Casas und späteren Bischof von Chiapas. Dem Eroberer und Kolonisten wurde vorgeworfen, den Handel mit afrikanischen Sklavinnen und Sklaven eingeführt oder zumindest angeregt zu haben. Lange Zeit hielt er ihren Einsatz für rechtmäßig, zu einem Sinneswandel kam es erst später.
Der digital hinzugeschaltete zweite Gastredner, Dr. Fidon Mwombeki, vormaliger VEM-Generalsekretär und heutiger Generalsekretär der All Africa Conference of Churches (AACC), wollte die Rolle der Missionare und die der Kolonialisten hingegen klar voneinander unterschieden haben. Nach seiner Auffassung folgten die Missionare ihrem göttlichen Ruf und brachten das Evangelium in die Welt, während es die Kolonialisten waren, die Land und Rohstoffe raubten, Gemeinschaften entzweiten und willkürlich Grenzen zogen und die im Freiheitskampf letztlich aus dem Land gejagt wurden. Die Errungenschaften missionarischer Tätigkeiten wie Bildung und fortschrittliche medizinische Versorgung würden indes in Afrika immer noch sehr wertgeschätzt.
Koloniales Erbe in der kirchlichen Partnerschaftsarbeit
Dennoch erkannte der tansanische Theologe sicht- und unsichtbare koloniale Spuren, die die Partnerschaftsarbeit zwischen afrikanischen und deutschen Kirchen bis heute prägen. Diese fasste er in vier Punkten zusammen:
1. Über- und Unterlegenheitshaltung. Aufgrund der kolonialhistorischen Geisteshaltung würden die Partnerschaften unter der Überlegenheitshaltung der Europäer*innen und der Unterlegenheitshaltung der Afrikaner*innen leiden. Begründet werde diese Einstellung mit der Vorstellung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Überlegenheit der Europäer*innen. Die afrikanische Seite würde hingegen mit Armut, Elend und Korruption in Verbindung gebracht. Afrikanische Erfolgsgeschichten gäbe es kaum. Beide Seiten könnten diese Geisteshaltung nur schwerlich abschütteln.
2. Geber*innen-Nehmer*innen-Gefälle. Auch hier gebe es immer noch die alte Rollenverteilung. Während die afrikanischen Partner*innen auf der Empfänger*innenseite stehen, gehören die Europäer*innen zu den Geber*innen. Mwombeki betonte, dass es in jedem Setting normal sei, dass der Gebende den Nehmenden bedauere. Dies habe nichts mit Kolonialismus zu tun, sondern mit wirtschaftlicher Überlegenheit, die es überall gebe. Andererseits, so der Theologe, sei es fraglich, ob Europäer*innen überhaupt Geld aus Afrika oder Asien annehmen würden. Europäische Partner*innen fühlten sich mit diesem Geld nicht immer wohl.
3. Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung. Afrikaner*innen betrachten Deutsche vornehmlich in der Lehrer*innenposition und damit als quasi allwissende Person. Der afrikanischen Seite werde hingegen wenig Expertentum zugeschrieben. So werden ordinierte afrikanische Pfarrer*innen in Deutschland oftmals als Assistent*innen behandelt. Das Führen einer eigenen Gemeinde traue man ihnen nicht zu.
4. Organisationelle und institutionelle Strukturen. Vielfach werden Kindergärten, Bibelschulen und Krankenhäuser nach deutschem Vorbild verwaltet und strukturiert. Kirchliche Pensionsfonds beispielsweise wurden ausschließlich von Missionar*innen eingerichtet.
Der Generalsekretär der AACC schlug vier Wege zur Überwindung kolonialer Ungleichheiten vor: 1. Bewusstmachen eigener historisch bedingter Geisteshaltungen. 2. Bewusstmachen, dass tiefgreifende Änderungen nur über Generationen stattfinden können. 3. Willen zur Veränderung negativer Geisteshaltungen, die Spaltungen unserer Gesellschaften begünstigen. 4. Vermeiden von Übersensibilisierungen und Selbstbeschimpfungen, die Partnerschaften unter ein Regime der Ängstlichkeit und Übervorsicht stellen.
In seinem abschließenden Ausblick wies Mwombeki darauf hin, dass derzeit eine weltweite Machtverschiebung zu beobachten sei und dass es nicht mehr die USA und Europa seien, die allein die Standards setzten. Außerdem werde sich aller Voraussicht nach auch das Tempo des wirtschaftlichen Aufschwungs zugunsten beispielsweise der BRIC-Staaten ändern, ganz zu schweigen von der pessimistischen Mitgliederentwicklung in den deutschen Kirchen. Beides werde einen Rückgang von Einfluss und Geld auf deutscher Seite mit sich bringen, der sich auch auf die kirchliche Partnerschaftsarbeit auswirken wird.
Koloniales Erbe in der Zivilgesellschaft
Als letzte Referentin sprach Gilberte Raymonde Driesen. Die Lehrerin, Diversitätstrainerin und Projektleiterin beim deutsch-senegalesischen Verein Axatin e.V. gab einen umfassenden Überblick über den Kolonialismus, seine historischen Wurzeln und seinen Zusammenhang mit dem Kapitalismus. Sie zeigte auf, welche Folgen das koloniale Handeln der Großmächte in den letzten Jahrhunderten für die Gesellschaften auf dem afrikanischen Kontinent hatten und wie groß der Einfluss damals getroffener Entscheidungen auch noch heute für die Menschen vor Ort ist; so führen beispielsweise die von den Kolonialherren im 19. Jahrhundert künstlich bestimmten Landesgrenzen nach wie vor zu Konflikten.
Gilberte Raymonde Driesen schlug dann den Bogen vom Kolonialismus zum Rassismus. Eindrücklich beschrieb sie, dass beides, Kolonialismus und Rassismus, auf allen Ebenen wirkt, sei es auf zwischenmenschlicher, institutioneller oder gesellschaftlich-kultureller Ebene. Es sei unumgänglich, sich mit der eigenen Historie auseinanderzusetzen und den eigenen Standort innerhalb der Gesellschaft zu reflektieren. In dem Zusammenhang betonte sie, wie wichtig ein gesamtgesellschaftliches Umdenken sei, um den Widerstand gegen des Trennende zu stärken bzw. die Dekolonisierung des Geistes voranzutreiben. Dies könne ihres Erachtens nur durch gemeinsame politische Bildung, die Bereitschaft, zuzuhören und das Einüben achtsamen Umgangs miteinander geschehen.
Nach den drei Vorträgen waren die Teilnehmenden des Fachforums am nächsten Tag gefordert, selbst aktiv zu werden. In Kleingruppen reflektierten sie zunächst über das tags zuvor Gehörte, identifizierten sie koloniale Kontinuitäten im eigenen Arbeitsbereich sowie in der eigenen Partnerschaftsarbeit und tauschten sich über mögliche Methoden zur Überwindung eben dieser aus. Im Plenum wurde einhellig festgestellt, dass man, bezogen auf den gesamten Themenkomplex, in den vergangenen Jahren schon einiges erreicht habe, es aber noch sehr viel zu tun gäbe.
Text und Fotos: Martina Pauly, VEM